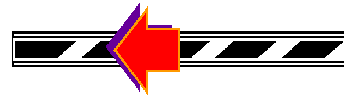
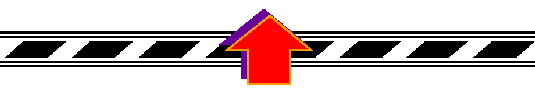

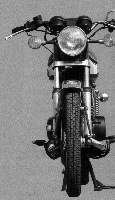 Die 250 ccm-Yamaha ist seit ihrem ersten Auftauchen bis heute kontuierlich
weiter entwickelt worden. Der Zweizylinder-Zweitaktmotor hat auf diese Weise
im Hause des grössten Zweitaktmotoren-Herstellers der Welt eine beachtliche
Reife erreicht. Nicht zuletzt spielen dabei auch die im Strassenrennsport gewonnenen
Erfahrungen eine grosse Rolle. Yamaha holte sich seit dem Eintritt in den Grand
Prix-Sport neun Weltmeisterschaften.
Die 250 ccm-Yamaha ist seit ihrem ersten Auftauchen bis heute kontuierlich
weiter entwickelt worden. Der Zweizylinder-Zweitaktmotor hat auf diese Weise
im Hause des grössten Zweitaktmotoren-Herstellers der Welt eine beachtliche
Reife erreicht. Nicht zuletzt spielen dabei auch die im Strassenrennsport gewonnenen
Erfahrungen eine grosse Rolle. Yamaha holte sich seit dem Eintritt in den Grand
Prix-Sport neun Weltmeisterschaften.
Unsere Testmaschine kam nagelneu zu uns und wurde vom Frühjahr bis zum Spätsommer 1973 insgesamt 11.300 Kilometer gefahren. Darunter war eine grössere Auslandfahrt über mehr als 5.000 Kilometer, und zum Schluss sollten einige schnelle Vergleichsrunden auf der 22,3 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgringes beweisen, dass noch nicht alle schönen PS aus dem Motor entfleucht waren.
Zuerst der Testkalender
Bei Testbeginn ging alles gut,
nach 600 km Fahrt allerdings fehlte zuerst der Splint zur Sicherung der hinteren
Achsmutter, die Einstellschraube des rechten Kettenspanners war weg, der Schmiernippel
an der Schwingenlagerung hatte sich dünngemacht, und der Drahtbügel
des Sitzbankverschlusses war locker, ausserdem waren Abblend- und Standlichtfaden
gebrochen. Obwohl von Vibrationen in den Lenkerenden, an den Fussrasten und
über die Knie am Tank kaum etwas zu spüren war, zweigten sich hier
doch die Auswirkungen von Schwingungen.
Bei Kilometerstand 1.539 brach die Tachometerwelle, ausserdem war das
Standlicht wieder defekt. Laut Aufzeichnungen lag der Kraftstoffverbrauch bei
etwa sieben Liter/100 Kilometer. Da die Maschine danach zu längeren Überlandfahrten
eingesetzt werden sollte, bekam sie einen BMW-Gepäckträger mit Krauser-Packtaschen.
Das war zwar eine abendfüllende und umständliche Bauerei, lohnt sich
für den Reisenden jedoch sehr. Das 16er Getrieberitzel wurde gegen ein
15er ausgetauscht, um für zwei Personen mit Gepäck im Gebirge mehr
Durchzugskraft zu bekommen.
Bei 1.829 Kilometern war die Tachobeleuchtung defekt, bei Kilometer 2.600
war der Abblendfaden wieder hin. Kilometerstand 3.700: Drehzahlmesserbeleuchtung
ausgefallen und Blinkerrelais in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Kilometerstand 4.000: Lenkradschloss klemmt und Zündaussetzer ab 7.000
U/min. Kilometerstand 4.161: Grosse Vorbereitung für eine Spanientour.
Dabei spendierten wir der RD 250 zwei neue Metzeler-Reifen Block C 55 (Auch
auf dem Vorderrad, denn dieses Profil ist gut für Vorderräder, wenn
es über staubige und unbefestigte Strassen und Wege gehen soll). Die Hinterradkette
machte noch einen guten Eindruck. Sie war aber auch alle 500 km gereinigt und
nachegspannt worden.
Auf der 5.000 Kilometer langen Reise passierte nichts besonderes. Kilometerstand
5.169: Vorderradbremse nachegstellt. Kilometerstand 5.200: Abblendfaden durch.
Kilometerstand 5.500: Gasschieber-Anschlagschraube verloren. Kilometerstand
6.000: Kerzen und Hinterradkette gereinigt. Kilometerstand 6.248: Kette gereinigt
(Alldieweil die Maschine in einem steinigen Land bewegt wurde). Kilometerstand
7.045: Kette gereinigt und nachgespannt (Zum reinigen und pflegen hatte man
ein wirksames Sprühmittel mitgenommen). Kilometerstand 7.200: Wieder Abblendfaden
durch. Kilometerstand 7.589: Blinkerrelais defekt. Kilometerstand 7.676: Kettenschlosssicherung
verloren. Kilometerstand 7.700: Schraube zur Befestigung der Tachoskala lose.
Kilometerstand 8.278: Kette gereinigt. Kilometerstand 8.896: Kette gereinigt.
Kilometerstand 9.300: Blinkerrelais (Bosch) defekt. Und dann war die Spanientour
vorüber.
Nun wurde die Maschine gründlich durchgesehen und für den Nürburgring
vorbereitet, ein 16er Getrieberitzel montiert.
Auf dem Nürburgring gab es keinen Ausfall und keine Schlosserei,
aber nach den schnellen Runden waren Abblendlicht, Standlicht und Drehzahlmesserbeleuchtung
hinüber.
Bei Kilometerstand 11.300 wurde der Test beendet.
Zwischenbilanz
Das, was uns zur Zeit bei allen
Motorädern wichtig ist, ist die unbedingt notwendige Erhöhung der
Zuverlässigkeit. Die RD 250 stellte sie unter Beweis, denn es gab in der
ganzen Testzeit bei ihr keinen Ausfall infolge eines Motor- oder Getriebeschadens,
nur Ärger mit Ausrüstungsdetails.
Der Motor
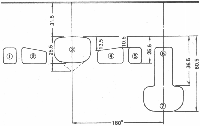 Er
leistet 30 DIN-PS bei 7.500 U/min. Ab 4.000 U/min ist es möglich, die Maschine
im grossen Gang zu beschleunigen. Die Membransteuerung verbessert den Füllungsgrad,
was sich besonders im unteren Drehzahlbereich zeigen soll. Die für Deutschland
notwendige Geräuschdämpfung hat jedoch scheinbar auf diese Verbesserung
keinen günstigen Einfluss, denn obwohl der Motor ab 4.000 U/min hochzieht,
ist das Verhältnis nicht so, wie das alte Fahrer z.B. von den früheren
250er Puch-Motorrädern kennen. Gegenüber dem vorhergehenden Yamaha-Modell
DS-7 kann man jedoch zweifellos von einer Verbesserung sprechen, was sich dann
ja auch bei der Nürburgring-Erprobung zeigte.
Er
leistet 30 DIN-PS bei 7.500 U/min. Ab 4.000 U/min ist es möglich, die Maschine
im grossen Gang zu beschleunigen. Die Membransteuerung verbessert den Füllungsgrad,
was sich besonders im unteren Drehzahlbereich zeigen soll. Die für Deutschland
notwendige Geräuschdämpfung hat jedoch scheinbar auf diese Verbesserung
keinen günstigen Einfluss, denn obwohl der Motor ab 4.000 U/min hochzieht,
ist das Verhältnis nicht so, wie das alte Fahrer z.B. von den früheren
250er Puch-Motorrädern kennen. Gegenüber dem vorhergehenden Yamaha-Modell
DS-7 kann man jedoch zweifellos von einer Verbesserung sprechen, was sich dann
ja auch bei der Nürburgring-Erprobung zeigte.
 Die Kurbelwelle ist sehr lang und dreht sich in vier Lagern;
die Zylinder haben sechs Kanäle, von der grösste in zwei Abschnitte
(siehe Kanalanordnung) geteilt ist, so dass Yamaha von "sieben" Kanälen
spricht.
Die Kurbelwelle ist sehr lang und dreht sich in vier Lagern;
die Zylinder haben sechs Kanäle, von der grösste in zwei Abschnitte
(siehe Kanalanordnung) geteilt ist, so dass Yamaha von "sieben" Kanälen
spricht.
Blaue Qualmwolken zog das Motorrad nicht hinter sich her, in den Schalldämpfern
fanden sich nur geringe Ölreste. Von Anfang an ist die Maschine flott gefahren
geworden, sie nahm Bummel- wie auch Hetzfahrten klaglos hin. Beim ersten Tritt
auf den Kickstarter war der Motor da. Zu Beginn des Tests kam es vor, dass der
Motor an Leistung verlor und unregelmässig lief, bis wir in den Vergasern
eine Menge Lackreste und winzige Metallspäne entdeckten, die aus dem Tank
dorthin gespült wurden. Bei neuen Fahrzeugen ist das nun mal möglich.
Auch zum Schluss, auf dem Nürburgring, hatte der Motor seine volle
Leistung. Auf der Endgerade lief die Maschine immer noch zwischen 156 und 158
km/h.
Kraftübertragung
Den Primärtrieb besorgen
schräg verzahnte Räder, das Getriebe hat von Haus aus sechs Gänge.
Aber in der Bundesrepublik kann man bei der Phonmessung nur mit fünf Gängen
günstig hin, so dass der sechste Gang "stillgelegt" ist. Wer
ihn benutzt, der fährt offizell mit einer nicht zugelassener Maschine!
Mit dem 16er Getrieberitzel ergeben sich in den Gängen die Gesamtübersetzungen
18,74/12,95/9,60/7,58/6,48.
Die Geschwindigkeiten in den fünf Gängen bei 7500 U/min betragen
45,6, 66,0, 89,0, 112,8 und 132,0 km/h. Da der Motor leicht bis 8500 U/min hochdrehte,
(8500 U/min = 152 km/h im fünften Gang) und auch bis auf knapp 9000 U/min
gebracht werden konnte, waren höhere Geschwindigkeiten möglich. Die
Fusschaltung hat nur kurze Wege und arbeitet genau.
Fahrwerk
Die Härte der Federung war
bei einer RD 250, die wir vor der Testmaschine zur Kurzerprobung hatten, ein
echtes Problem und wurde von uns mit KONI-Federbeinen verbessert. Auch die Testmaschine
hatte serienmässig sehr harte Federbeine, die jedoch zu ertragen waren.
Ein Beweis dafür, dass es hier auch in der Serie Unterschiede gibt, wobei
aber darauf zu achten ist, ob die Härte nicht etwa an den zu engen Befestigungsaugen,
an der Schwingenlagerung oder an Defekten in den Federbeinen selbst liegt
Der Nürburgring brachte dann an den Tag, dass der Durchschnitt von
11.20 für die 22,3 Kilometer lange Messstrecke in Höhe von 118,2 km/h
ca. 76% der erzielten Endgeschwindigkeit von 156 km/h auf dem Nürburgring
ist. 74,5% von 159 km/h. (159 km/h ging das Motorrad auf dem Hockenheimring.)
Die Telegabel von Yamaha kommt einigermassen gut mit, wenn Unebenheiten
auf der Strassenoberfläche Schwingungen erzeugen. Allerdings darf der Abstand
zwischen den einzelnen Löchern nicht zu eng werden!
Auf dem Nürburgring
Eine Zeit von 11.20 = 118,2 km/h
Durchschnitt ist 1973 auf der Nordschleife des Nürburgrings eine gute Zeit.
(Stehend am Start und das Ende der Messstrecke gebremst.) Dass der Motor durchzieht,
das zeigt die lange Steigung bei Kilometer 12 im Kesselchen, wo er bei ca. 7%
im fünften Gang noch fast 150 km/h schafft. Dieser Durchzug ist seine Stärker,
hinzu kommen die Kurvenlage und die Spurtreue der Maschine, wobei heute der
"glatte" Nürburgring ja fast schon keine Probleme mehr schafft.
Nordkurve: 90-100 km/h, Hatzenbach-Ecken: 90-115 km/h, Aremberg-Kurve: 90 km/h,
Bergwerg-Kurve: 100 km/h (bei Kilometer 11), Kurve an der hohen Acht (Kilometer
15): über 100 km/h! Aber da wurde die mögliche Schräglage durch
die unter den Auspuffrohren herumgeführten Fussrastenhalterungen begrenzt.
Es wurde im Bereich zwischen 6000 und 8500 U/min gefahren, und wir kamen
meist mit dem vierten und fünften Gang aus.
Alltagsbetrieb
Im normalen Verkehr ist so eine
spritzige 250 ccm-Maschine eine feine Sache. Man braucht sie nicht zu überfordern,
um König zu bleiben. Die Drehzahlen steigen nicht in astronomische Höhen,
denn auf der Landstrasse bleibt der Fahrer im Drehzahlbereich zwischen 4000
und 6000 U/min im grossen Gang.
Nur auf der Autobahn wird es dann wieder hitziger. Aber das machte der
RD 250 nichts. Sie hat keine thermischen Schwierigkeiten gezeigt. Der Verbrauch
stieg auf der Autobahn auf 7,5 Liter/100 Kilometer an. Der Gesamtdurchschnitt
während der Testzeit betrug 6,64 Liter/100 Kilomter.
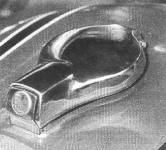

Links abgeschlossener Tankdeckel,
rechts die Klaviatur des linken Lenkerendes.

Der Einfüllstutzen liegt
viel zu dicht an der Batterie.
Zubehör und Ausrüstung
Hier haben wir uns verschiedentlich
über "Gammel" geärgert. Zum Beispiel das oft zerschüttelte
Blinkerrelais, oder die vielen defekten Lampen. Dazu kommt der "Bierflaschenverschluss"
der Sitzbankverriegelung, die zerschüttelten Innereien des Tachometers.
Und wenn noch etwas zu meckern ist: Was soll die rote Kontrollleuchte für
die Bremsfunktion? Wenn eine Bremse nicht "tut", dann braucht man
dazu keine leuchtende rote Lampe. Wenn diese - parallel mit dem Stopplicht geschaltete
- Lampe fünf Minuten v o r der nächsten Bremsaktion aufleuchten
würde, falls eine Bremse defekt ist, dann wäre es ein echter Gag.
Übrigens funktionierte die hydraulisch betätigte Scheibenbremse im
Vorderrad zusammen mit der Hinterrad-Trommelbremse enorm: Aus 80 km/h stand
das Motorrad nach maximal 25 Meter.
Tageskilometer im Tachometer: Gut. Abschliessbarer Tankverschluss: Gut.
Tankinhalt: 16 Liter - Aktionsradius ca. 250 Kilometer. Öltankinhalt 2
Liter. Die Sitzposition ist im ganzen bequem, die Fusshebel sind lang, die Fussrasten
leider nicht verstellbar. Zwei Personen haben auf der Sitzbank Platz, aber nach
200 Kilometer ist jeder der beiden froh, wenn es eine Tankpause gibt.
An die Schalter und Knöpfe an den beiden Lenkerenden muss der Fahrer
sich erst gewöhnen, bis er wie ein Klavierspieler ohne hinzuschauen jeweils
den richtigen Knopf oder Fingerhebel erwischt. Bei Lenkermontagen sollte niemand
leichtsinnigerweise an diese Hebelarmaturen rangehen und womöglich die
Kabellösen, denn nur mit einer die Geduld sprapazierenden Technik wird
er alle Anschlüsse, Federchen, Knöpfe und Halterungen wieder richtig
zusammenfummeln können.
Was uns im täglichen Umgang auch nicht gefallen hat, das ist der
sehr klein dimensionierte Öleinfüllstutzen unter der Sitzbank, neben
dem die Batterie untergebracht ist. Beim Ölnachfüllen ohne Trichter
muss genau "gezielt" werden, sonst ist in dieser Gegend immer eine
feine Ölsauerei zu bemerken. Das Schauglas für die Ölstandskontrolle
gehört übrigens zu den täglichen Beobachtungspunkten. Ausserdem
lohnt sich die regelmässige Kontrolle und Säuberung des Ablagerungstopfes
am Kraftstoffhahn. Wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass
Gemischabmagerung bei hochdrehenden Motoren schnell durch zugesetzte oder eingeengte
Kraftstoffzuleitungen und fehlende Tankbelüftung möglich ist. Erfolg:
Ratsch - ein blitzschneller Kolbenklemmer!
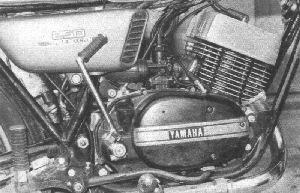
Feine Zylinderverrippung, langer
Fussbremshebel.
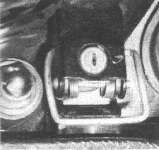
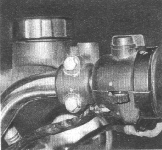
Links der billig geratene Sitzbankverschluss,
rechts Kurzschlussschalter.
Was halten wir von der RD 250?
Zuverlässiger Motor, sehr
leistungsfähig, so dass sportliches Fahren mit hohen Durchschnitten möglich
ist. Was uns nicht gefällt: DIese Geschichte mit des "verkappten"
Sechsganggetriebes und der an der Testmaschine aufgetretende Ärger mit
Zubehör ud Ausrüstung. Das verlangt eine Menge "Nacharbeit"
durch den Fahrer.
Auf dem Nürburgring war es die bisher schnellste von uns gefahrene 250er.


Links Telegabel mit Scheibenbremse,
rechts die Grundlinie der 250/350 ccm Yamaha ist unverändert geblieben.
Technische Daten
(Motor siehe Vergleichtabelle unten)
Primärübersetzung 68/21 = 3,238. Übersetzungen in den fünf
Gängen 2,571/1,778/1,318/1,040/0,889. Hinterradübersetzung 36/16 =
2,25. Bereifung vorn 3.00-18, hinten 3.50-18. Tankinhalt 16 Liter, Öltankinhalt
2 Liter. Trockengewicht 144 kg. Radstand 1320 mm.
Yamaha RD 250 im Vergleich |
|||||||||
(Leistungsangaben nach Fabrik oder Importeur. Ohne Gewähr) |
Yamaha |
Benelli |
Honda |
Kawasaki |
Ducati |
Maico |
MZ ETS |
Pannonia |
Suzuki |
Motor 2-/4-Takt |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Zylinderzahl |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Ventil- bzw. |
Schlitze |
Schlitze |
ohc |
Schlitze |
ohc |
Schlitze |
Schlitze |
Schlitze |
Schlitze |
Bohrung / Hub (mm) |
54/54 |
56/47 |
56/50,6 |
45/52,5 |
75/58 |
76/54 |
69/65 |
56/50 |
54/54 |
Hubraum (ccm) |
247 |
231 |
249 |
249 |
245 |
245 |
241 |
246 |
247 |
Leistung (PS bei U/min) |
30/7500 |
25/7000 |
30/10500 |
28/7500 |
22/8500 |
27/7800 |
19/5500 |
23/7500 |
25,5/8000 |
Hubraumleistung |
121,5 |
- |
- |
- |
90 |
110 |
79 |
93,5 |
103 |
Kolbengeschwindigkeit |
13,5 |
11,0 |
17,7 |
13,1 |
16,4 |
14,0 |
11,9 |
12,5 |
14,4 |
Leistungsgewicht (kg/PS) |
4,9 |
5,5 |
5,67 |
4,3 |
5,9 |
4,1 |
8,1 |
6,3 |
5,7 |
Anzahl der Gänge |
5(6) |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
Starter-Art |
Kick |
Kick |
Kick/E |
Kick |
Kick |
Kick |
Kick |
Kick |
Kick |
Preis DM (ohne Gewähr) |
3295,- |
3190,- |
3248,- |
3490,- |
3495,- |
3300,- |
2490,- |
2790,- |
3299,- |
* Keine klaren Angaben, ob DIN-PS, b.h.p., SAE-PS oder Cuna-PS |
|||||||||
Stand 22.09.2002