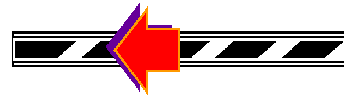
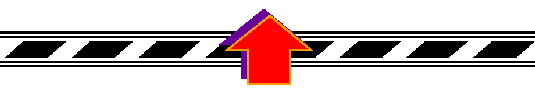

Klein, aber oho! - Yamaha RD: Einfacher, wilder und schneller als so manches Schwergewicht
RD - dieses Kürzel stand in den 70er Jahren als Synonym für alltagstaugliche und bezahlbare Sportmaschinen von Yamaha. Die Zweitakter spalteten eine ganze Generation Motorradfahrer: Entweder man liebte sie oder hasste sie.
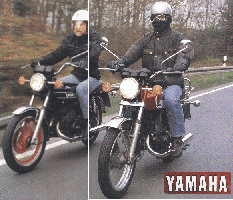 "Sch...", dachte ich noch , bevor ich
mich vom wegrutschenden Motorrad löste und über den glatten Asphalt
auf den Graben zurutschte. Dort überschlug ich mich und kamm nach einigen
Sekunden wieder zur Besinnung. Zum zweiten Mal hatten die unter den Auspufftöpfen
verlaufenden Fussrastenbügel mich noch vor dem Scheitelpunkt einer forsch
gefahrenen Bergaufkurve im oberhessischen Bergland ausgehebelt. Zum Glück
war nicht viel passiert!
"Sch...", dachte ich noch , bevor ich
mich vom wegrutschenden Motorrad löste und über den glatten Asphalt
auf den Graben zurutschte. Dort überschlug ich mich und kamm nach einigen
Sekunden wieder zur Besinnung. Zum zweiten Mal hatten die unter den Auspufftöpfen
verlaufenden Fussrastenbügel mich noch vor dem Scheitelpunkt einer forsch
gefahrenen Bergaufkurve im oberhessischen Bergland ausgehebelt. Zum Glück
war nicht viel passiert!
Soweit meine markanteste persönliche Erinnerung an die gute alte RD. Nicht umsonst kritisierten Journalisten die mangelnde Bodenfreiheit als eines der wenigen Mankos an den sonst flinken Maschinen. Yamaha reagierte auf die Kritik an den "Enterhaken" unter den Chromtöpfen erst 1978. Da war der Stern der Zweitakttwins schon wieder im Sinken begriffen. Noch zwei Jahre zuvor war die RD 250 das meist verkaufte Motorrad in Westdeutschland gewesen!
Begonnen hatte die weltweite Erfolgsstory 1973. Auch der deutsche Motorradmarkt boomte. Am beliebtesten war die 250er Klasse, die sportlichen Fahrspass bei bezahlbaren Anschaffungs- und Unterhaltskosten versprach - Kraftstoffverbrauch war in der Republik der Käferfahrer kein Thema. Zweitakter in Motorräder waren durchaus populär, auf den Rennstrecken der Welt gaben sie in den Soloklassen bis 350 Kubik im wahrsten Sinn des Wortes den Ton an.
Die Zweitaktfans aus Iwata wussten, wie wichtig Rennerfolge für die Kaufentscheidung ihrer Kundschaft waren. Yamaha hatte seit den Sechzigern mit unglaublich simplen, schlitzgesteuerten und luftgekühlten Twins der TD und TR-Baureihen in den Klassen 250 und 350 Kubik den Konkurrenten das Siegen schwergemacht. Nun produzierte die Marke mit den drei Stimmgabeln im Logo noch dazu am laufenden Band Production-Racer, konkurrenzfähige, käufliche Rennmaschinen. Kurzum, auf der Piste besorgten es die von Strassenfahrzeugen abstammenden Maschinen der komplizierteren Konkurrenz gründlich.
Nachdem aus den Strassenmaschinen in den Sechzigern flinke Renner geworden waren, ging die Entwicklung nun den umgekehrten Weg. Folgerichtig hiessen die neuen 250er und 350er Yamaha-Twins, die im Frühjahr in den Vertretungen standen, nun "RD" wie Race Development (Rennsportentwicklung). Im Kern basierte das Zweizylinderduo auf den bereits 1971 vorgestellten Modellen DS7 (250 Kubik) und R5F (350 Kubik). Den schlanken Doppelrahmen, das horizontal geteilte Motorgehäuse und die 18-Zoll-Räder mit der Trommelbremse im Hinterrad hatte Yamaha beibehalten. Neu waren der grössere Tank nebst entsprechender Sitzbank, die hydraulisch betätigte Scheibenbremse am Vorderrad, die Kontrollleuchten zwischen Tacho und Drehzahlmesser sowie viele Details, darunter der - in den Augen der meisten Fahrer und Tester zu hohe - Tourenlenker. Doch am wichtigsten war das überarbeitete Triebwerk. Die Yamaha-Techniker liessen den Einlass von Membranen regeln, versahen die Zylinder mit sieben statt fünf Kanälen und verpassten dem Getriebe sechs statt fünf Gänge. Der fehlende Elektrostarter wurde kaum moniert, schliesslich liess sich eine korrekt justierte RD selbst mit der Hand anwerfen.
Der Knaller an der prinzipiell unspektakulären RD250 war die Höchstleistung von 30 PS. Mit rund 30 PS waren zwar auch die Erzkonkurrenten Honda CB 250 ud Suzuki GT 250 angegeben, aber Yamaha konnte auf eine Leistungsmessung nach DIN (mit Schalldämpfern und Nebenaggregaten) verweisen. Hier mussten die anderen passen! Doch zugleich goss man den deutschen Motorradfans Wasser in den Wein, als die Techniker des Importeurs Mitsui den sechsten Gang sperren mussten, um mit der nicht gerade flüsterleisen Yamaha die Hürden des TÜV-Mustergutachten zu nehmen. Die Geräuschmessung erfolgte beim Beschleunigen im zweiten und dritten Gang, und da drehte die Original-RD zu schnell hoch. Also sperrte man kurzerhand den sechsten Gang und baute eine längere Endübersetzung ein.
Der 350er ging es ähnlich, doch weil sie bei nur wenig Mehrgewicht 40 Prozent mehr Hubraum hatte und dementsprechend bulliger antrat, fiel dieses Manko hier nicht so sehr auf. Die RD250 konnte zwar mit stolzen 2,95 mKg Drehmoment aufwarten, diese lagen allerdings erst 500 Umdrehungen unterhalb der Höchstleistungsmarke von 7500 U/min an. Damit war für Eingeweihte schon von der Papierform her klar, was der Pilot im Fahrbetrieb rasch merkte: Das ausgesprochene "unelastische" Triebwerk wollte mit Drehzahl und Gangwahl auf Trab gehalten werden. Da es die Konkurrenz kaum besser machte und viele 250er Käufer von den extrem nervösen Kleinkrafträdern kamen, nahmen sie den dürftigen Durchzug in niederen Drehzahlen - das hiess hier unterhalb von 5000 U/min! - achselzuckend in Kauf.
Preislich lag die RD250 mit 3295
Mark genau dort, wo sich die japanische Konkurrenz tummelte. Was billiger war,
etwa die MZ ETS 250 oder die ungarische Pannonia P20, war auch langsamer und
bot ein schlichteres Finsih. Hier brillierte die Yamaha mit hochwertiger Metalflake-Tanklackierung,
tadellosem Chrom und generell guter Verarbeitung. Kritik bezog sich - wie bei
den Konkurrenten - auf die offene Kette, den immer noch zu kleinen Tank und
die zu schwach gedämpften, bockigen Federbeine. Auch die Reifen von Dunlop
oder Yokohama konnten es in der Haftung nicht mit Metzeler oder Cintinental
aufnehmen. Ansonsten eitel Sonnenschein: Vorzügliche Elektrik, gute Bremsen,
ein steifer Rahmen und der kräftige Motor überzeugten die Käufer.
Rasch wurde die RD250 zum Topseller ihrer Klasse. Nach und nach rüsteten
viele Fahrer einen Magura-M-Lenker, Koni-Federbeine, Metzeler-Reifen, einen
H-4-Einsatz und Innensechskantschrauben nach. Damit war man 1974 prima angezogen!
|
|
Unverbastelt und unrestauriert: Das Schicksal war gnädig zu dieser 1975er RD250 |
|
Sportfahrer, die bereit waren, die in der Haftpflichtversicherung
doppelt so teure RD350 zu unterhalten, gehörten zu den Schnellen im Land.
Die vollgetankt nur 163 Kilogramm schwere RD350 galt mit ihren 39 PS als "Leistungsbarbar".
EIne Beschleunigung aus dem Stand bis 100 km/h in 6,1 Sekunden und eine Spitze
von mehr als 160 km/h mit sitzendem Fahrer reichthen aus, um die meisten Halblitermaschinen
und auch viele europäischen Big Bikes das Nachsehen zu geben. Das Fahrwerk
war zwar nicht gefährlich, bot aber niemals die Reserven einer Morini oder
Ducati 350 Desmo. Schnell hatten die starken Yamaha einen zweifelhaften Ruf
als "Witwenmacher". Schuld war allerdings eher der lebensverneinende
Fahrstil mancher Piloten ... Nicht nur die Versicherungsprämie der RD350
verschlang manche Mark: Wie bei der kleinen Schwester starben Birnen und Blinkrelais
oft einen raschen Tod, und wer richtig auftrete, hatte den 14,5 Liter fassende
Tank nach 130 Kilometern trocken gefahren.
Sechs Gänge versprichth das Kurbelgehäuse, deutsche Kunden durften nur fünf nutzen |
Nichts besonderes: Die Lenkerarmaturen entsprachen dem gewöhnten Japan-Standard |
Er wirkte äusserlich unscheinbar, hatte es aber faustdick unter den Zylinderdeckeln: Der simple Yamaha-Twin lieferte bereits im zivilen Strassentrim 30 PS ab |
|
Die Kontrollleuchten fristen ihr Dasein in einer simplen Konsole - aber wen an diesem Cockpit etwas anderes als die Nadel im rechten Rundinstrument interessierte, der hatte definitiv das falsche Motorrad gekauft! |
1974 änderte sich ausser dem Tankdekor wenig, erst 1975 gab
es Modellpflege zu verzeichnen: Ein abermals neues Dekor am Tank, der endlich
freigelegte sechste Gang, eine Leistungsspritze von zwei PS für die Viertellitermaschine
und die vier Zentimeter längeren Auspufftöpfe, die trotz gestiegener
Leistung beide RD leiser machten. Optimal übersetzt, mit flachem Lenker
und kleinem Piloten, konnte die RD250 nun ebenfalls die 160er Marke kratzen,
was in dieser Hubraumklasse schon eine Ansage war. Trotz des gestiegenen Preises
behauptete die RD250 ihre Pole Position in der Zulassungsstatistik.
Eine verbesserte Kurbelwellenwuchtung
erhöhte nicht nur die Lebensdauer der Lampen. Denoch waren die RD250 und
350 selbst bei korrekter Wartung keine Maschinen für die Ewigkeit. Oft
wurde bei 25000 Kilometern ein Ausschleifen der Zylinder und der Einbau von
Übermasskolben angeraten. Die meisten durchlöcherten Kolben oder Klemmer
waren wohl auf Wartungsmängel zurückzuführen. Speziell die Kontaktzündung
verzieh keine Schlampereien. Auch unkundiges Tuning oder eine zu knappe Bedüsung
vertrugen die schnellen RD nicht. Die Bedienungsanleitung empfahl sogar spezifische
Zündkerzen für Stadt- oder Überlandverkehr!
1976 kam unter dem altbekannten Namen ein fast neues Motorrad auf den Markt: Mit "Sargtank", längerem Rahmen und einer Bremsscheibe im Hinterrad suchte Yamaha den Anschluss an die Moderne. |
1976 erschien unter dem alten Namen ein äusserlich fast neues
Motorrad. Die barocken Linien waren passé. Mit einer Scheibenbremse auch
am Hinterrad, längerem Chassis, dem intern "Sargtank" genannten
Spritbehälter und vielen neu gestylten Details suchte Yamaha den Anschluss
an die Moderne. Es blieb zunächst bei 32 PS, bis Ende des Jahres die deutschen
Assekuranzen zuschlugen und die bisher geltenden Haftpflichtklassen nach Hubraum
abschafften und stattdessen nach PS-Leistung abrechneten. Wer mehr als 27 PS
unter dem Tank hatte, musste bluten. Selbst die bald populäre Klasse von
17 bis 27 PS erforderte von Anfängern den Einsatz von rund 800 Mark nur
für die jährliche Haftpflichtprämie! Für die 30 und 32 PS
starken RD entwickelte Mitsui in Löhne rasch Drosselsätze, die den
Kunden etliche Hunderte Prämie im Jahr sparten.
Von der Piste in die Grossserie - die RD wurde dem gern missbrauchten Klischee gerecht |
|
1978 wurde die RD nochmal überarbeitet |
Hohes Gewicht, Triebwerk in Gummi: Die RD400 machte ohne Erfolg auf komfortabel |
1977 erhielt die als Topseller von der Yamaha XS abgelöste
RD250 optische Modellpflege in Form von Gussrädern und einem Pllastikbürzel
am Sitzbankheck. Die Räder waren zwar pflegeleichter, aber auch schwerer
als die alten Drahtspeichenräder mit Stahlfelgen. Der Wohlstandspeck sorgte
dafür, dass die 1977er RD nun vollgetankt mit Werkzeug und Öl an der
170-Kilo-Marke lag und vor allem die 27-PS-Version spürbar an Temperament
verlor. Dank weiter verfeinerter Verarbeitung sowie reduzierter Verdichtung
und Nenndrehzahl erwies sich die 250er als zuverlässiger und pflegeleichter
denn je und traf so den Geschmack von Tourenfahrern. Für "Fahrer die
nach Leistung fragen" (O-Ton Yamaha-Werbung) hatten sich die Strategen
in Iwata etwas Neues ausgedacht: Ende 1975 schickten sie die RD350 in Pension
und begegneten dem Trend zu weniger Krach und mehr Fahrkomfort mit der RD400.
Diese 400er besass zwar die 64er Kolben der RD350, aber 62 Millimeter Hub und erfoderte so als erste RD eine andere Kurbelwelle. Der lange Hub brachte den lang ersehnten Durchzug, die Spitzenleistung stieg hingegen nur um bescheidene drei PS, die auf der Strecke vom höheren Gewicht aufgefressen wurden. Der lange Rahmen samt Schwinge, dazu grössere Auspufftöpfe gegenüber der Urversion, ein grösserer Tank und besonders die Gussräder mit den bleischweren Scheibenbremsen liessen das Gewicht steigen. Dafür gab es Komfortgimmicks, die der 350er fehlten, wie einen Vorauslass zum leichteren Starten oder einen Schlitz im auslassseitigen Kolbenhemd gegen Schieberuckeln. Die RD400 protzte nicht ein Jahr vor der 250er, sondern auch als erstes Serienmotorrad überhaupt mit den modischen Leichtmetallgussfelgen. Gusstechnische Probleme führten übrigens zur Scheibenbremse am Hinterrad.
Aufgrund der bekannten Probleme mit der Laufkultur des Twins hängte Yamaha das Triebwerk in Gummi, es wirkte fortan seidenweich. Als sportliche Fahrmaschine mit geringen Wartungsansprüchen und viel Fahrkomfort wurde die RD400 in allen Tests gelobt - doch fast niemand kaufte sie. Zum einen bot die 4500 Mark teure Yamaha mit ihrer schlichten Erscheinung wenig Image. Zum anderen forderten die Assekuranzen jährlich rund 1500 Mark Haftpflichtprämie, während für die RD250 "nur" die Hälfte der Summe fällig war. Noch dazu gab es gleich am Anfang ein Debakel mit Löchern in den Kolben, da die 400er den 1976 erstmalig bleireduzierten Kraftstoff nur schlecht vertrug, bis dickere Kopfdichtungen Abhilfe schafften. Auch massive Modellpflege 1978 konnte die Absatzsituation nicht mehr verbessern: Mit japanischer Gründlichkeit spendierten die Yamaha-Techniker ihrem einstigen Flagschiff weiter hinter platzierte Rasten, deren Halterungen nun endlich über dem Auspuff lagen, eine CDI-Zündung, leichtere Schwenksattelbremsen, akzeptable Federbeine, eine stärkere Telegabel und ein Druckausgleich für den Einlassstrakt. Die "Fahrmaschine" RD war so weit perfektioniert worden, dass die Tester nur noch am lächerlichen Kettenschutz herummäkeln konnten. Lediglich ein H-4-Einsatz fehlte immer noch, wurde aber seit 1973 von fast jedem Fahrer nachgerüstet.
Die Änderungen an der 400er
kamen 1978 auch der RD250 zugute. Diese war nun im Wortsinn "tadellos",
im Verkauf aber von der viertaktenden Yamaha XS360 abgehängt worden. Die
Käufer hatten rasch erkannt, dass die Versicherungsprämien viertaktende
Drosselmotoren bevorzugten und diese im Alltag oft angenhmere Partner waren.
Der Zündkerzenwechsel an der Stadtgrenze war genauso gestrig wie extreme
Vollgasverbräuche oder die verpönte Geruchswolke hinter den Chromtöpfen.
Der heutige Marktwert * |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modell |
Baujahr |
Note 1 |
Note 2 |
Note 3 |
Note 4 |
Note 5 |
Neupreis |
RD 250 |
1973 bis 1975 |
2200 EUR |
1500 EUR |
1000 EUR |
600 EUR |
200 EUR |
3300 DM |
RD 350 |
1973 bis 1975 |
2500 EUR |
1800 EUR |
1200 EUR |
600 EUR |
200 EUR |
3550 DM |
RD 250/400 |
1976 bis 1979 |
2100 EUR |
1400 EUR |
1000 EUR |
600 EUR |
200 EUR |
4500 DM |
* Ermittelt von Classic Data GmbH, Wittener Str. 105, 44575 Castrop-Rauxel, Tel. 02305/29011 |
|||||||
Die Moderne hält unaufhaltsam Einzug: Ohne kantiges Cockpit, Gussräder und kleinem ... |
|
... Heckbürzel lässt 1978 kein Marketingmann mehr ein Motorrad auf die Menschheit los |
Die Versicherungswirtschaft als Konstrukteur: Ab 1977 hat der muntere Twin nur noch 27 PS |
Modell 1978 mit veränderter Fussrastenanlage, modifizierten Gussfelgen und Schwingsattelbremsen |
|
Der RD-Bestand sollte in den folgenden Jahren rasch dezimiert werden.
Behagliche Dahinroller, die ihr Motorrad lieber putzten, kauften keine RD. Statt
dessen ritten Anfänger, Übermütige und Schlamper die einst zu
Tausenden verkauften Zweitakttwins in Grund und Boden. Nur ein ganz harter Kern
der Aufdreher hoffte auf eine Zweitaktzukunft. Und sie behielten Recht: Der
bärenstarke, wassergekühlte Motor und das zierliche Cantileverfahrwerk
der Nachfolgemodelle RD250/350LC brachten 1980 pure Renntechnik auf die Strasse
und machten damit ihrem Namen endlich wieder Ehre!
Die rasante "Lufthutze" über den Zylindern gönnte Yamaha nur den USA-Modellen der RD-Reihe |
Einfach, aber ehrlich: Membraneinlass und lastabhängige Ölpumpe machten den RD-Twin noch lange nicht zum Hightech-Triebwerk |
Technische Daten: Yamaha RD250 / 350 / 400 |
|||
|
|||
Modelle |
RD250 |
(RD350) |
RD400 |
Motor |
Luftgekühlter Zweizylinder-Zweitaktreihenmotor mit Siebenkanal-Umkehrspülung und Flachkolben; membrangesteuert |
||
Bohrung x Hub |
54 x 54 mm |
64 x 54 mm |
64 x 62 mm |
Hubraum |
247 ccm |
347 ccm |
399 ccm |
PS bei U/min |
30 bei 7500 (ab 1975: 32 bei 8000; ab 1977: 27 bei 7200) |
39 bei 7500 |
43 bei 7100 |
Vergaser |
Zwei Mikuni VM28 |
||
Zündung |
Batteriespulenzündung mit zwei Kontakten und zwei Spulen; ab 1978: CDI-Zündung mit einer Doppel-Zündspule |
||
Schmierung |
Getrenntschmierung mit last- und drehzahlabhängiger Pumpe |
||
Antrieb |
Primärantrieb über Zahnräder; Mehrscheibenkupplung im Ölbad; Sechsganggetriebe; Hinterradantrieb über ungekapselte Rollenkette |
||
Fahrwerk |
Doppelrohrrahmen; vorn hydraulisch gedämpfte Telegabel; hinten Schwinge mit zwei Federbeinen |
||
Bremsen |
Vorn eine Scheibe; hinten eine Vollnabentrommel, ab 1976 eine Scheibe |
||
Bereifung |
vorn 3.00 S 18 TT, hinten 3.50 S 18 TT |
||
Leergwicht |
155 kg; ab 1976: 176 kg |
160 kg |
165 kg; ab 1977: 177 kg |
Verbrauch Ø |
5 bis 8 Liter/100 km |
||
Spitze |
155 km/h |
165 km/h |
165 km/h |
Liebe auf den dritten Blick (1978)
 Die erste Begegnung ist eher ernüchternd:
Die sachliche Optik der RD 400 ruft weder bei Oldtimerfans noch bei Freunden
der Moderne Begeisterung hervor. Das Gewicht ist nicht nur optisch spürbar.
Viele kleine Wünsche und produktionstechnische Sparsamkeit wie schwere
Räder und Bremsen aus Eisenguss haben das Gewicht hochgetrieben, so dass
die RD 400 nicht als "klein und gemein" gelten kann. Doch der Zweitakter
startet schon beim scharfen Hinsehen und fällt sogleich in einen regelmässigen
Leerlauf mit dumpfen Verbrennungsgeräuschen.
Die erste Begegnung ist eher ernüchternd:
Die sachliche Optik der RD 400 ruft weder bei Oldtimerfans noch bei Freunden
der Moderne Begeisterung hervor. Das Gewicht ist nicht nur optisch spürbar.
Viele kleine Wünsche und produktionstechnische Sparsamkeit wie schwere
Räder und Bremsen aus Eisenguss haben das Gewicht hochgetrieben, so dass
die RD 400 nicht als "klein und gemein" gelten kann. Doch der Zweitakter
startet schon beim scharfen Hinsehen und fällt sogleich in einen regelmässigen
Leerlauf mit dumpfen Verbrennungsgeräuschen.
Anders als die "scharfe" RD 350 stemmt die RD 400 mehr
als 4 mKg schon bei gut 5000 U/min auf die Welle, so dass man durchaus sanft
summend mit niedrigen Drehzahlen durch die Stadt puttern kann. Auf freier Strecke
ist man mit dumpfen Zweitaktton bei Drehzahlen zwischen 4000 und 6000 U/min
schnell genug unterwegs, um auch mit modernen Fahrzeugen mithalten zu können.
Hoch drehen bringt nicht viel, oberhalb von 7500 U/min wird das nahezu quadratisch
ausgelegte Triebwerk zäh. Das Sechsganggetriebe, das die 250er und 350er
so dringend brauchten, ist bei der 400er mehr Verkaufsgag denn Notwendigkeit.
Das Fahrverhalten ist, gemessen an damaligen Standards, mehr als akzeptabel.
Nachrüstfederbeine und europäische Reifen waren schonn vor 20 Jahren
Pflichtprogramm ambitionierter Sportfahrer. Dafür ist die Handlichkeit
trotz vollschlanken 170 kg ausgezeichnet. Der Zweitakter konzentriert die Massen
in Höhe der Radnaben. Mit wenig gefülltem Tank befindet sich
kaum Gewicht am Lenkkopf, was die Lenkung leicht hält. Unterwegs freue
ich mich über die ausgezeichneten Scheibenbremsen, die bequeme "englische"
Sitzposition und den niedrigen Verbrauch von rund sechs Litern Normalsprit auf
100 Kilometern, den mir niemand glaubt. Jemand hat den Lenker einer BMW /6 montiert,
ein damals durchaus üblicher Umbau.
Sportlich fahren geht noch heute, begeistern können hohe Kurvengeschwindigkeiten dank niedrigen Schwerpunkt und schmaler Reifen. Wer es übertreibt, dem wird aber nicht verziehen, sondern er fliegt dank geringer Bodenfreiheit und unsensibler Lenkung mit zuviel Nachlauf ab. Ganz so wie es mir einst erging. Europäische Untersteurer à la Benelli oder MZ haben mehr Reserven für Unfug auf der Strasse. Doch wer im Reigen der Siebziger-Jahre-Zweitakter keine puristisch vibrierende Rennsemmel à la Maico MD 250 oder auch keinen überschweren Wackel-Wasserbüffel mag, fondet bei den RD-Modellen, speziell den 350er und 400er, die goldene Mitte zwischen Kraft, Kultur und Fahrspass. "Liebe auf den dritten Blick hält oft ein Leben lang", schrieb Tester Franz-Josef Schermer 1978 als Einleitung zur RD 400. Dem ist nichts hinzufügen.
Stand 15.02.2003